Manchmal kommt es vor, dass man bei all dem Schreiben ganz das Lesen vergisst. Ziemlich Schade, wie ich finde. Deswegen nehme ich mir ab jetzt hin und wieder die Zeit, ein altes Buch aus dem Regal zu kramen und einen Blogbeitrag darüber zu verfassen. Was macht dieses Buch aus? Und warum habe ich es so gerne gelesen? Darum soll es in dieser Reihe gehen. Den Anfang macht, wie der Titel verrät, Cornelia Funkes „Reckless“-Reihe. Ich habe Spoiler vermieden, wenn ihr was das angeht aber sehr empfindlich seid, solltet ihr vielleicht zuerst das Buch lesen.
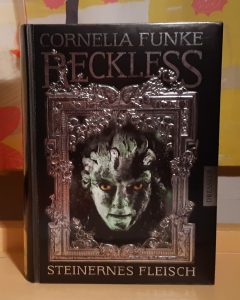
Worum geht es?
Hatte ich nicht neulich noch über Märchen gesprochen? Tja, in diesem Buch erwachen sie alle zum Leben, wenn auch anders, als man es sich vielleicht vorstellt: Als Jacob Reckless den mysteriösen Spiegel im Arbeitszimmer seines Vaters entdeckt, öffnet sich ihm eine neue Welt. Das ist wortwörtlich gemeint, denn der Spiegel entpuppt sich als Portal in eine andere Realität, in der Märchengestalten genauso alltäglich und real sind wie der Sonnenaufgang. Zwölf Jahre später hat er diese Welt zu seinem zweiten Zuhause und sich selbst einen Namen als begnadeter Schatzjäger gemacht. Ein Rapunzelhaar, ein Tischlein-deck-dich, alles kein Problem. Jacob Reckless kann es finden. Doch dann folgt sein Bruder Will ihm hinter den Spiegel und fällt einem gefährlichem Fluch zum Opfer. Was folgt ist ein Rennen gegen die Zeit, das Jacob nur sehr ungern verlieren würde…
Worldbuilding
„Was willst du hier?“, flüsterte die fremde Nacht ihr zu, „welche Haut soll ich dir geben? Willst du Fell? Willst du Stein?“
Cornelia Funke, „Reckless – Steinernes Fleisch“
Ich glaube, ich habe selten so viele Sagen und Erzählungen so nahtlos in eine gemeinsame Geschichte einfließen sehen. Die bekanntesten Märchen der Grimms sind alle irgendwo in die Kulisse der Spiegelwelt eingepinselt, auf herrlich unaufdringliche Art. Dabei schwingt dem Ganzen auch ein Gefühl der Entzauberung mit: Ja, Märchen sind real. Und sie sind ziemlich bedrohlich, dreckig und angsteinflößend, wenn man nicht mit ihnen umzugehen weiß. Am Rande der Geschichte landen Jacob und seine Begleiter in einem mit Rosen zugewucherten Schloss. Doch der Prinz ist dort wohl nie angekommen: Die Prinzessin samt Gefolge sind mittlerweile nahezu mumifiziert. Ungefähr die Hälfte der Wesen am Wegesrand hat es auf Leib und Leben der Protagonisten abgesehen, und die Adeligen intrigieren hinter dem Spiegel genauso wie in den Geschichtsbüchern.
Obwohl so viele Märchen und Legenden im Hintergrund präsent sind, gelingt es, eine vollkommen eigenständige Geschichte zu erzählen. Die alten Sagen sind nur das Bühnenbild, vor dem die Brüder reiten, oder, viel mehr noch, das Werkzeug in Jacobs Tasche.
Es gibt auch einige Elemente, die nicht aus Märchen entnommen wurden. Die gefürchteten Goyl, die sehr wichtig für den Verlauf der Geschichte sind, existieren zum Beispiel nur in diesem Buch.
Was ich persönlich immer sehr gerne an dem Buch mochte, waren die kleinen Spielereien in der Namensgebung. Das fängt schon bei Will und Jacob Reckless selbst an: Es wird wohl kaum ein Zufall sein, dass so viele der Geschöpfe, denen sie begegnen, von ihren Namensvettern Jakob und Wilhelm Grimm zu Papier gebracht wurden.
Im Vergleich dazu hat es wirklich viel zu lange gedauert, bis mir auffiel dass Ähnliches auch mit den Namen der Länder hinter dem Spiegel passiert war. Hier wird allerdings mit den Namen realer Länder gespielt: Das Land, in dem Jacob sich aufhält, trägt beispielsweise den Namen „Austrien“ und wir von der Hauptstadt „Vena“ aus regiert. Klingelt da etwas?
In den späteren Bänden werden übrigens auch die Sagenwelten anderer Länder erkundet, auf ähnliche Weise.
Charaktere
(…) in dieser Welt gab es für alles eine Medizin. Er musste sie nur finden.
Cornelia Funke, „Reckless – Steinernes Fleisch“
Die Charaktere sind ohne Zweifel das Beste an diesem Buch. Jacob Reckless gehört wohl zu den wenigen Fantasyprotagonisten, die den Konflikten ihrer Welt neutral gegenüber stehen. Er verfolgt tatsächlich nur seine eigenen Interessen. Dabei erweckt er allerdings nie den Eindruck von Selbstsucht oder Egoismus, ganz im Gegenteil: Jacob versucht nach Leibeskräften, seinen Bruder und seine Beglieterin Fuchsnzu schützen. Er ist nicht perfekt, sicher, immerhin hat sein Drang, seiner Heimatwelt zu entfliehen, ihn immer weiter von seiner Familie entfernt, aber es macht Spaß, ihn bei seiner Suche zu begleiten. Für Jacob scheint nichts wirklich unmöglich. Er muss nur der richtigen Legende folgen, um irgendeinen Zauber oder Gegenstand in die Hände zu bekommen, der das Problem für ihn beseitigt. Das klappt nicht immer so richtig, aber in den meisten Fällen verschafft es ihm zumindest mehr Zeit.
Diese Neutralität des Protagonisten bringt den Leser in eine ziemlich seltene Situation. In der Welt hinter dem Spiegel herrscht Krieg, die Goyl gegen die Menschen. Es ist in der Geschichte ziemlich präsent, aber dadurch, dass der Protagonist keine Stellung bezieht, müssen wir das auch nicht. Das Buch erwartet von uns nicht, dass wir eine der Seiten als „Gut“ oder „Böse“ ansehen, und so können wir sowohl mit dem starken Goylkönig Kami`en, den die Menschenwelt fasziniert, als auch mit der berechnenden Kaiserin Therese von Austrien sympathisieren. Wir können es aber auch bleiben lassen.
Auch die anderen Charaktere haben ihr Päckchen zu tragen. Fuchs, die Gestaltenwandlerin mit der schweren Kindheit, deren geliebtes Fell ihr langsam die Lebenszeit raubt, oder Clara, die Krankenschwester, die sich auf der Suche nach ihrem Freund in diese Märchenwelt verirrt hat, und sich jetzt wohl oder übel mit ihren Schrecken anfinden muss. Will, der sanftere der Brüder, verliert sich langsam in dem Stein, den der Fluch einer Fee in seiner Haut wachsen lässt. Die Beziehungen zwischen den Protagonisten ist sehr glaubhaft und sehr schön illustriert, auch ihre persönlichen Sorgen und Nöte kommen immer wieder gut zum Vorschein, ohne zu penetrant zu wirken.
Das Buch bringt es irgendwie fertig, dass man sogar den verschlagenen Zwerg ins Herz schließt, der seine Auftritte nur damit verbringt, Jacob und die anderen (vielleicht) über den Tisch zu ziehen, und der eigentlich nur hinter Jacobs Goldbaum her ist.
Schreibstil
Und er hörte wieder den Felsen zu. Ließ sie Bilder malen. Und zu Stein machen, was weich in ihm war.
Cornelia Funke, „Reckless – steinernes Fleisch“
Kann mir irgendjemand erklären, wie man die Innere Handlung der Figuren so fließend mit einer Umgebungsbeschreibung verweben kann? Ich habe nämlich keine Ahnung, wie die Autorin das hinbekommen hat. Das einzige,was ich weiß, ist, dass ich mir nur selten so sehr wünsche, Malen oder Zeichnen zu können, wie wenn ich dieses Buch lese. Es gibt einfach so viele Szenen, die direkt als bunte Bilder in meinem Kopf auftauchen, und das ist wirklich unglaublich.
Viele der Verwandlungen, die verschiedene Charaktere durchlaufen, funktionieren auf zwei Ebenen. Fuchs zieht ihre Tiergestalt ihrer tatsächlichen vor, weil sie die Menschenhaut mit Verletzlichkeit verbindet, und während sowohl Wills Äußeres als auch sein Inneres langsam versteinert, spült es alte Vorwürfe an den abwesenden Bruder nach oben, die der verständnisvolle Jüngere wohl selbst nicht wahrhaben wollte.
Ich könnte vermutlich noch seitenlang weiter über dieses Buch schreiben, aber der Blogbeitrag muss an dieser Stelle dann doch ein Ende finden. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Format etwas anfangen. Es ist etwas, das ich von jetzt an gerne öfter machen würde.
Welche Bücher sind für euch auch nach Jahren noch echte Lieblinge? Lasst es mich ruhig wissen!
Zu guter letzt noch eine Ankündigung: Ich werde hier vermutlich in den nächsten zwei Monaten nichts mehr hochladen. Das ist also für eine Weile der letzte Beitrag. Aber danach bin ich wieder da!
Bis dann, und habt eine schöne Zeit!


Neueste Kommentare